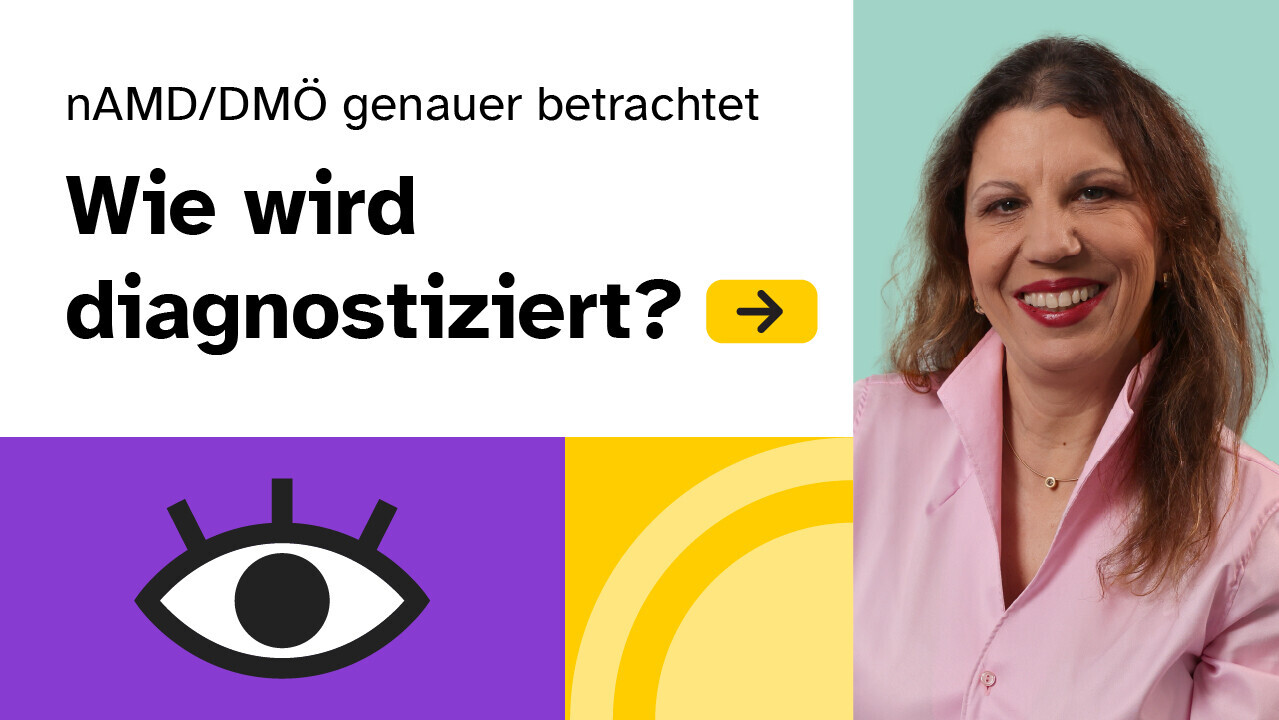Fluoreszenzangiographie (FAG) zur Diagnose von Netzhauterkrankungen
Die Fluoreszenzangiographie (FAG) ermöglicht es, den Augenhintergrund samt der Netzhautgefäße zu beurteilen. Bei der Untersuchung wird ein unschädlicher Farbstoff in die Ellenbeuge gespritzt, der sich dann bis in die Gefäße der Netzhaut verteilt. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt kann so Gefäßveränderungen in der Netzhaut beurteilen und eine Netzhauterkrankung feststellen.

Erschienen am 26.09.2022
Was kann eine Fluoreszenzangiografie aufdecken?
Eine allmählich nachlassende Sehschärfe ist ein normaler Alterungsprozess. Wenn die Sehverschlechterung jedoch über das übliche Maß hinaus geht und Sie beispielsweise Straßenlinien, Fensterrahmen oder auch Gesichter verzerrt sehen, könnte dies auf eine neovaskuläre altersabhängige Makuladegeneration (nAMD/feuchte AMD), ein diabetisches Makulaödem (DMÖ) oder ein Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV) hinweisen.
Eine Fluoreszenzangiographie (FAG) kann in solchen Fällen häufig Klarheit schaffen. Mit dieser Untersuchung kann Ihre Augenärztin oder Ihr Augenarzt häufig die Ursache oder das Stadium der Netzhauterkrankung feststellen, geeignete Behandlungsverfahren vorschlagen und den Verlauf der Erkrankung unter der Therapie beurteilen.1,2,3
Wie wird eine Fluoreszenzangiografie durchgeführt?
Vor der Untersuchung werden zunächst die Pupillen durch Augentropfen erweitert, damit ein Blick auf die Netzhaut möglich ist. Ein Farbstoff, der Ihnen dann über eine Armvene gespritzt wird, kommt innerhalb von ca. 10 bis 15 Sekunden über das Blut in den Gefäßen am Augenhintergrund an.
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt beleuchtet den Farbstoff mit blauem Licht, wodurch undichte oder unerwünschte neu gebildete Blutgefäße sichtbar werden. Die mit dem Farbstoff gefüllten Gefäße und die Netzhaut werden danach mit einer speziellen Kamera mehrmals fotografiert. Die Untersuchung dauert etwa 20 Minuten.4
Im Video erklärt Augenärztin Dr. Astrid Sader-Moritz am Beispiel der nAMD, wie die FAG zur Diagnose beiträgt.
Die Untersuchung mittels FAG ist in der Regel sehr gut verträglich. Da der Farbstoff auch in andere Gefäße des Körpers gelangt, können sich Haut und Schleimhäute nach der Untersuchung gelb färben. Dies ist ungefährlich und verschwindet innerhalb weniger Stunden von selbst. Der Farbstoff wird über die Nieren ausgeschieden, sodass sich auch der Urin für einige Zeit gelb verfärben kann.4

Nach der Untersuchung
Sie sollten für den Nachhauseweg vorsichtshalber eine Sonnenbrille mitnehmen, weil Ihre Augen nach der Untersuchung durch die Pupillenerweiterung lichtempfindlich sein können. Auch dürfen Sie für den Rest des Tages kein Fahrzeug führen und sollten Ihre Rückfahrt nach Hause entsprechend planen.
Wer übernimmt die Kosten für eine FAG?
Die FAG ist eine Kassenleistung und wird von Ihrer Krankenkasse übernommen. Falls Ihre Augenarztpraxis die notwendigen Geräte nicht besitzt, ist gegebenenfalls eine Überweisung an eine andere Praxis oder Klinik notwendig. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt kann Ihnen eine entsprechende Praxis empfehlen.
Um die Diagnose zu sichern, erfolgen neben der FAG in der Regel weitere Untersuchungen. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird Sie über die weiteren Schritte informieren und Ihnen anschließend die möglichen Behandlungsmöglichkeiten vorstellen. Nehmen Sie diese Informationen in Ruhe auf – an dieser Stelle müssen Sie noch keine Entscheidung hinsichtlich der Behandlung treffen.
Zusammenfassung
Mithilfe der Fluoreszenzangiografie (FAG) können verschiedene Netzhauterkrankungen wie eine nAMD, ein DMÖ oder ein RVV beurteilt werden. Ein Farbstoff, der über eine Armvene gespritzt wird, gelangt über das Blut in die Gefäße im Augenhintergrund. Undichte oder unerwünschte neu gebildete Blutgefäße werden sichtbar.
Inhaltlich geprüft: M-DE-00026825
1. Anti-VEGF-Therapie bei der neovaskulären altersabhängigen Makuladegeneration. Stellungnahme der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, der Retinologischen Gesellschaft und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschland, zuletzt abgerufen am 15.01.2025.
2. Therapie des diabetischen Makulaödems. Stellungnahme der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, der Retinologischen Gesellschaft und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands, zuletzt abgerufen am 15.01.2025.
3. Intravitreale Therapie des visusmindernden Makulaödems bei retinalem Venenverschluss. Stellungnahme des Berufsverbande der Augenärzte Deutschlands, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und der Retinologischen Gesellschaft, zuletzt abgerufen am 15.01.2025.
4. Heimann H et al. Fluorescein-Angiographie. In: Angiographie-Atlas des Augenhintergrundes. 2004. Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart., zuletzt abgerufen am 15.01.2025.